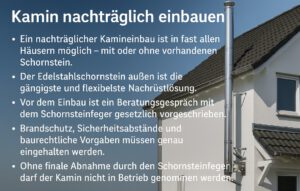Kamin nachträglich einbauen: So klappt’s wirklich!
Man kann in nahezu jedem Haus einen Kamin nachträglich einbauen– ob im Altbau, Neubau oder sogar in Mietobjekten. Die wohlige Wärme, die Energieeinsparung und die optische Aufwertung machen den Kamineinbau attraktiv. Allerdings erfordert der nachträgliche Einbau eine sorgfältige Planung, technische Expertise und die Einhaltung rechtlicher Vorschriften. Von der Auswahl des passenden Modells über die Schornsteinfrage bis hin zur Abnahme durch den Schornsteinfeger – dieser Ratgeber zeigt Ihnen Schritt für Schritt, worauf Sie achten müssen.
Das Wichtigste in Kürze zum Kamin nachträglich einbauen:
- Ein nachträglicher Kamineinbau ist in fast allen Häusern möglich – mit oder ohne vorhandenen Schornstein.
- Der Edelstahlschornstein außen ist die gängigste und flexibelste Nachrüstlösung.
- Vor dem Einbau ist ein Beratungsgespräch mit dem Schornsteinfeger gesetzlich vorgeschrieben.
- Brandschutz, Sicherheitsabstände und baurechtliche Vorgaben müssen genau eingehalten werden.
- Ohne finale Abnahme durch den Schornsteinfeger darf der Kamin nicht in Betrieb genommen werden.
Kann man einen Kamin nachträglich einbauen?
Ja, ein Kamin kann in den meisten Häusern auch nachträglich eingebaut werden. Voraussetzung ist entweder ein vorhandener Schornstein oder ein nachgerüsteter Edelstahlschornstein. Vor dem Einbau müssen Brandschutzvorgaben und gesetzliche Regelungen beachtet und der Einbau vom Schornsteinfeger genehmigt werden.
Voraussetzungen für den nachträglichen Kamineinbau
Bevor ein Kamin nachträglich eingebaut werden kann, ist eine grundlegende Planung nötig. Besonders wichtig ist dabei ein geeigneter Schornsteinanschluss. Ist kein Schornstein vorhanden, kann ein doppelwandiger Edelstahlschornstein außen an der Fassade oder innerhalb des Hauses installiert werden. Dabei spielen bauliche Faktoren wie die Statik, die Geschossanzahl und bestehende Leitungssysteme eine Rolle.
Ein weiteres zentrales Thema ist der Brandschutz. Der Kamin muss auf einem feuerfesten Untergrund stehen. Bei Holzböden ist eine Funkenschutzplatte aus Glas oder Metall zwingend erforderlich. Auch die Abstände zu brennbaren Materialien sind gesetzlich geregelt:
| Bereich | Mindestabstand |
|---|---|
| Nach vorne (zur Feueröffnung) | 50 cm |
| Seitlich zum Bodenbelag | 30 cm |
| Zu massiven Wänden/Decken | 20 cm |
| Zu brennbaren Verkleidungen | 45 cm |
| Zu Möbeln | 80 cm |
Wichtig: Auch Mieter können theoretisch einen Kamin nachrüsten – aber nur mit Zustimmung des Vermieters. In Niedrigenergiehäusern ist zudem ein externer Frischluftanschluss erforderlich.
Rechtliche Vorschriften und Genehmigungen
Der Einbau eines Kamins unterliegt in Deutschland verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV). Sie regelt unter anderem die zulässigen Emissionsgrenzwerte für Feinstaub und Kohlenmonoxid. Diese Werte variieren je nach Ofenmodell und Baujahr.
Zusätzlich ist die Abnahme durch den Schornsteinfeger gesetzlich vorgeschrieben. Dieser kontrolliert die Feuerstätte vor der ersten Inbetriebnahme. Ohne diese Abnahme darf der Kamin nicht betrieben werden. Bei Neubauten oder umfassenden Sanierungen greifen außerdem Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). In besonders luftdichten Häusern ist etwa eine kontrollierte Frischluftzufuhr nötig, damit der Kamin keine Unterdruckprobleme verursacht.
Veränderungen an der Fassade – etwa durch einen Außenschornstein – können eine Baugenehmigung erfordern. Auch Denkmalschutzbestimmungen müssen gegebenenfalls berücksichtigt werden. Die Planung sollte daher frühzeitig mit Architekt, Bauamt und Schornsteinfeger abgestimmt werden.
Schornstein nachrüsten – welche Optionen gibt es?
Fehlt ein geeigneter Schornstein, kann dieser nachgerüstet werden. Die gängigste Lösung ist der Edelstahl-Außenschornstein. Er wird an der Fassade montiert und ist aufgrund seiner doppelwandigen Konstruktion brandsicher und isoliert. Er kann nahezu überall eingesetzt werden und ist vergleichsweise kostengünstig.
Alternativ ist der Einbau eines Schornsteins im Innenbereich möglich. Das ist jedoch aufwendiger, da Wände und Decken durchbrochen werden müssen. Bei Neubauten oder umfangreichen Sanierungen kann auch ein Leichtbauschornstein eine Option sein. Er besteht aus vorgefertigten Elementen und lässt sich platzsparend integrieren.
Die Dimensionierung des Schornsteins muss zur Heizleistung des Ofens passen. Diese Prüfung erfolgt durch den Schornsteinfeger. Er gibt auch Empfehlungen zur Zuglänge und zum geeigneten Montageort.
Kaminofen, Kachelofen oder offener Kamin?
Die Auswahl an Kaminarten ist groß. Besonders beliebt sind Kaminöfen, da sie einfach zu installieren sind und relativ geringe Anschaffungskosten haben. Sie eignen sich hervorragend zur punktuellen Beheizung einzelner Räume. Viele Modelle verfügen über ein Sichtfenster und bringen so echtes Feuererlebnis ins Haus.
Kachelöfen speichern Wärme länger und geben sie über Stunden hinweg ab. Sie eignen sich eher für größere Räume oder Häuser mit hohem Wärmebedarf. Der Einbau ist allerdings komplexer und kostenintensiver.
Offene Kamine bieten das klassischste Feuererlebnis, sind aber energetisch ineffizient und dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen betrieben werden. In vielen Fällen ist ein Betrieb nur mit Glastür zulässig.
Moderne Geräte erfüllen die BImSchV-Vorgaben und sind oft mit automatischer Luftregelung, Speichermodulen oder wasserführender Technik ausgestattet – ideal für die Integration in bestehende Heizsysteme.
Kamin nachträglich einbauen: Ablauf und Zeitplan beim Kamineinbau
Ein Kamin lässt sich in wenigen Tagen fachgerecht nachrüsten – vorausgesetzt, die Vorbereitung ist abgeschlossen. Zunächst erfolgt die Beratung durch den Schornsteinfeger. Er prüft den Standort, den Schornsteinzug und die Luftversorgung. Anschließend wählt man das passende Ofenmodell aus.
Nach Bestellung und Lieferung des Ofens folgt die Installation durch einen Fachbetrieb. Dabei wird der Ofen aufgestellt, das Rauchrohr montiert und mit dem Schornstein verbunden. Wenn ein neuer Schornstein nötig ist, wird dieser meist zuerst installiert.
Nach Abschluss aller Arbeiten prüft der Schornsteinfeger erneut die Sicherheit, den Rauchabzug und die Emissionen. Erst danach darf der Kamin betrieben werden. Vom Erstgespräch bis zur ersten Befeuerung vergehen in der Regel zwei bis vier Wochen – abhängig von Verfügbarkeit und Aufwand.
Kostenübersicht: Womit muss man rechnen?
Die Preise für den nachträglichen Einbau eines Kamins hängen von vielen Faktoren ab. Einfache Kaminöfen gibt es ab etwa 800 Euro. Hinzu kommen Kosten für das Rauchrohr, Montage und Zubehör. Ein Edelstahl-Außenschornstein schlägt mit etwa 1.000 bis 2.500 Euro zu Buche – je nach Länge und Komplexität.
Wer sich für einen gemauerten Kamin oder Kachelofen entscheidet, muss mit 5.000 bis 10.000 Euro rechnen. Zusätzliche Aufwendungen entstehen bei statischen Anpassungen, Wanddurchbrüchen oder speziellen Brandschutzmaßnahmen.
Die folgende Tabelle bietet eine grobe Orientierung:
| Kostenpunkt | Preisspanne |
|---|---|
| Kaminofen | 800 – 3.000 € |
| Edelstahlschornstein | 1.000 – 2.500 € |
| Montage durch Fachbetrieb | 500 – 1.500 € |
| Genehmigungen/Abnahme | 150 – 300 € |
| Kachelofen oder Mauerwerk | 5.000 – 10.000 € |
🔥 Vergleichstabelle: Kaminofen, Kachelofen & offener Kamin
| Kaminart | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|
| Kaminofen | – Günstig in der Anschaffung – Einfache Nachrüstung – Schnelle Wärmeabgabe – Große Modellauswahl |
– Geringe Speicherleistung – Häufigeres Nachlegen von Holz nötig |
| Kachelofen | – Sehr hohe Wärmespeicherung – Langsame, gleichmäßige Wärmeabgabe – Ideal für Dauerbetrieb |
– Hohe Anschaffungskosten – Aufwendiger Einbau – Mehr Platzbedarf |
| Offener Kamin | – Romantische Atmosphäre – Direktes Feuererlebnis – Traditionelles Design |
– Geringer Wirkungsgrad – Hoher Holzverbrauch – Nur eingeschränkter Betrieb erlaubt |

Häufige Fehler beim nachträglichen Kamineinbau
Wer einen Kamin nachrüstet, sollte typische Fehler vermeiden, um spätere Kosten, Sicherheitsprobleme oder rechtliche Konflikte zu verhindern. Ein häufiger Fehler ist die mangelhafte Planung des Schornsteinverlaufs. Wird dieser falsch dimensioniert oder ungünstig positioniert, kann das den Zug stören und die Verbrennung beeinträchtigen. Auch das Ignorieren gesetzlicher Abstände zu brennbaren Materialien stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Manche Bauherren sparen zudem an der Beratung durch den Schornsteinfeger – dabei ist diese gesetzlich vorgeschrieben und essenziell für die Genehmigung. Ein weiteres Problem: nicht passende Ofenmodelle für das jeweilige Gebäude, etwa bei zu hoher Heizleistung in kleinen Räumen. Wer sich frühzeitig mit Fachbetrieben, Architekten und Behörden abstimmt, verhindert teure Nachbesserungen und gefährliche Situationen.
Schritt-für-Schritt-Checkliste für den Kamineinbau
- Beratung durch den Schornsteinfeger: Klären Sie vorab, ob ein bestehender Schornstein genutzt werden kann oder ein neuer nötig ist.
- Ofenmodell wählen: Je nach Raumgröße, Heizbedarf und gewünschtem Design.
- Schornstein planen: Innen oder außen, Materialwahl, Zuglänge – stets in Abstimmung mit Fachbetrieben.
- Genehmigungen einholen: Je nach Bundesland und Bauart kann eine Baugenehmigung erforderlich sein.
- Installation durchführen lassen: Ausschließlich durch qualifizierte Fachbetriebe mit Schornsteinfeger-Abstimmung.
- Abnahme durch den Schornsteinfeger: Unverzichtbar für die erste Inbetriebnahme.
- Kamin nutzen: Nach Freigabe genießen Sie sichere Wärme – mit gutem Gewissen.
Förderung und Steuerliche Vorteile beim Kamineinbau
Ein nachträglicher Kamineinbau kann nicht nur Heizkosten senken, sondern auch finanziell gefördert werden. Je nach Bundesland und Effizienzklasse des Ofens gibt es Förderprogramme für emissionsarme Feuerstätten. Vor allem wasserführende Kamine, die an das Heizsystem angeschlossen sind, profitieren von Zuschüssen im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Auch steuerlich lassen sich Handwerkerkosten teilweise geltend machen – bis zu 20 % der Lohnkosten sind absetzbar. Voraussetzung ist eine korrekte Rechnungsstellung und die unbare Zahlung. Vor Beginn der Maßnahme sollte man sich bei KfW, BAFA oder dem Steuerberater über die aktuellen Möglichkeiten informieren. So wird der Kamineinbau nicht nur wohnlicher, sondern auch wirtschaftlich attraktiv.
Fazit
Ein Kamin sorgt nicht nur für wohlige Wärme, sondern auch für Wertsteigerung und Effizienz. Wer den Einbau sorgfältig plant, kann ihn nahezu überall realisieren. Besonders Edelstahlschornsteine bieten flexible Nachrüstlösungen. Wichtig ist die Zusammenarbeit mit Fachbetrieben und dem Schornsteinfeger. Dann steht der gemütlichen Kaminzeit nichts mehr im Wege.
Quellen:
- Mein Eigenheim: Kamin nachträglich einbauen: Darauf sollten Sie achten
- Heizung.de: Kamin nachrüsten: Kosten & Voraussetzungen
- Ofenseite: Diese Kaminofen-Vorschriften sollten Sie beachten!
- ofen.de: Einen Schornstein bzw. Kamin nachrüsten: Welche Möglichkeiten gibt es?
- Engel & Völkers: Kaminsysteme nachträglich einbauen: Darauf müssen Sie achten